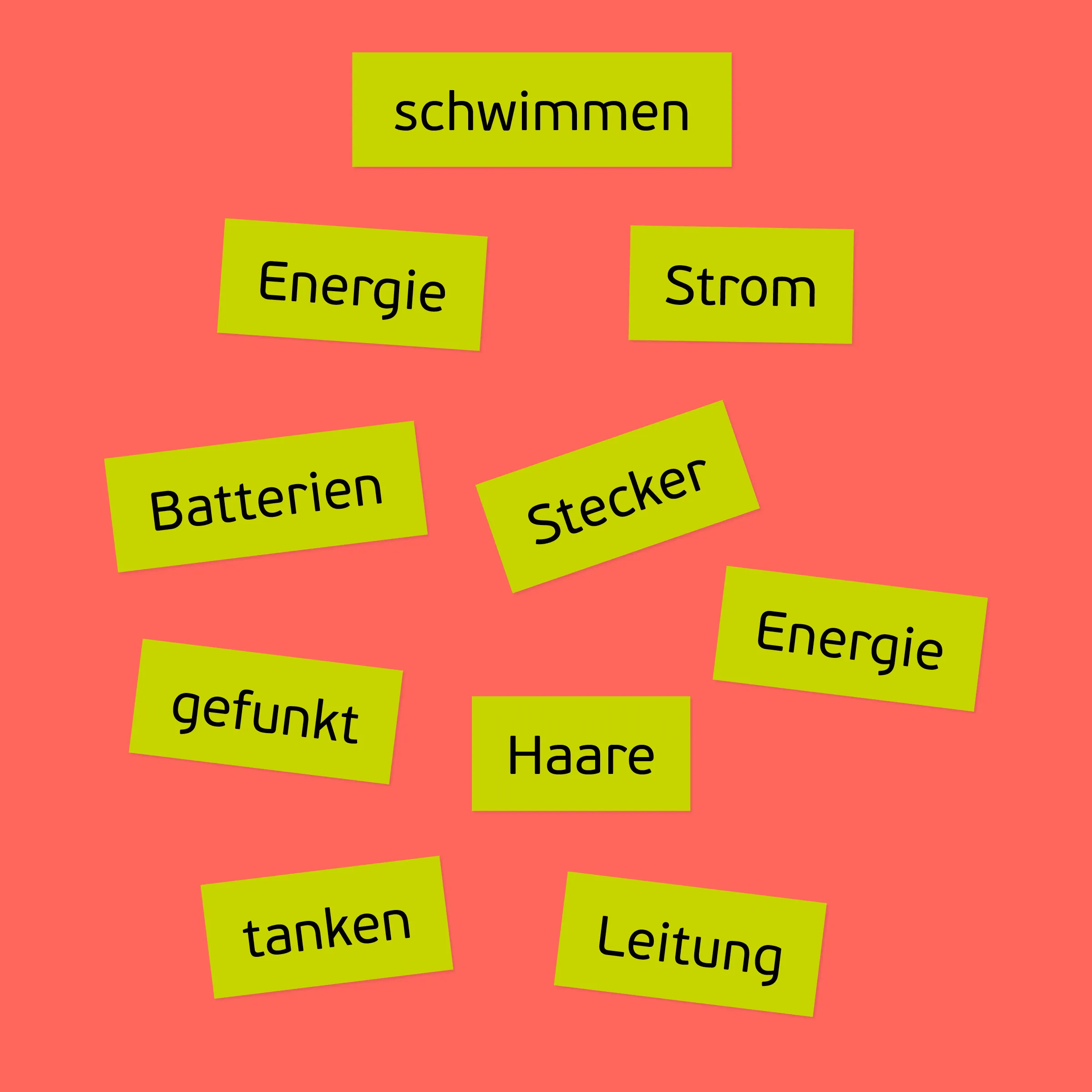Vom Kolben zum Kabel
Vergaser, Zylinderkopf, Nockenwelle, Einspritzdüsen, Pleuel – all das prägte das Autofahren über Jahrzehnte. Doch heute klingen diese Teile wie Technik von gestern. Die Zukunft fährt elektrisch! Aber wie funktioniert ein E-Auto eigentlich? Die Antwort: überraschend einfach. Lesen Sie hier mehr dazu!
Fast wie ein Verbrenner – aber mit anderen Komponenten
Grundsätzlich besteht ein Elektroauto, genau wie ein Verbrenner, aus einem Fahrzeugrumpf, Rädern und einem Antrieb, der die Räder bewegt und damit die Karosserie in Bewegung setzt. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in den Antriebskomponenten.
Was den E-Antrieb ausmacht
Der E-Antrieb umfasst: den Elektromotor mit Antriebswelle und Getriebe, den Energiespeicher (Batterie oder Akku), verschiedene elektronische Systeme (Leistungselektronik, On-Board-Ladegerät, Batteriemanagement-System) sowie ein Kühlsystem.
Strom statt Sprit – so fließt die Energie
Die elektrische Energie gelangt über Stromkabel, Ladegeräte mit unterschiedlichen Steckertypen sowie verschiedene Wechsel- und Gleichrichter von der Ladestation zur Batterie und schliesslich zum Motor.
Das Gehirn des E-Autos
Die Steuerzentrale eines Elektroautos ist die Leistungselektronik, die das Zusammenspiel aller Komponenten koordiniert.

Gute Gründe für den Umstieg
Vorteile von Elektroautos: lokal emissionsfrei, hoher Wirkungsgrad, verschleissarme Motoren, keine Vibrationen, minimale Geräuschentwicklung und ein nutzbarer Drehmomentbereich über das gesamte Geschwindigkeitsspektrum hinweg.
Mehr Wirkungsgrad, weniger Verlust
E-Fahrzeuge sind deutlich effizienter als Verbrenner. Sie nutzen über 90 % der eingesetzten Energie, während selbst die besten Verbrennungsmotoren nur etwa 40 % Wirkungsgrad erreichen.
Energie bleibt Energie – nur anders
Das physikalische Grundprinzip bleibt ähnlich: Chemische Energie wird in Bewegungsenergie umgewandelt – bei Elektroautos wie auch bei Verbrennern.
Der wichtigste Unterschied: Rekuperation
Der Hauptunterschied: Beim E-Auto ist es möglich, Bewegungsenergie wieder in elektrische und chemische Energie umzuwandeln – ein Prozess, der als «Rekuperation» bezeichnet wird.
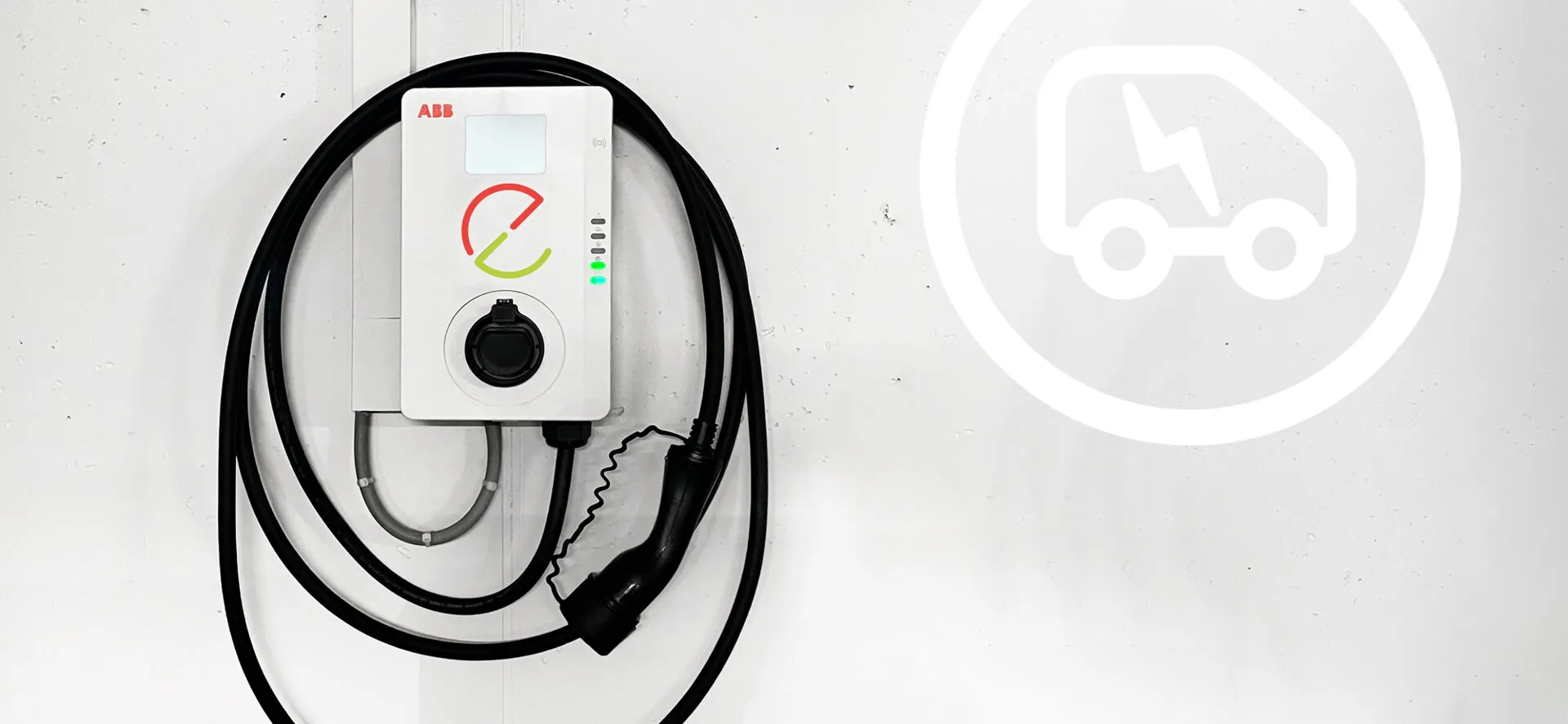
Rückwärts ist nicht nötig
Dank des breiten Wirkungsspektrums von Drehzahl und Drehmoment ist in den meisten Fällen ein einfaches Unterstützungssystem ausreichend. Ein separates Rückwärtsgetriebe ist nicht nötig, da der Elektromotor in beide Richtungen arbeiten kann.
Clever heizen mit Abwärme
Allerdings führt die geringe Abwärme des E-Motors zu einem erhöhten Energiebedarf fürs Heizen. Hier kommt oft eine Wärmepumpe zum Einsatz, um die Energie der Batterie effizienter zu nutzen.
Kühlsystem mit Köpfchen
Besonders komplex ist das Thermomanagement der Batterie. Der Akku muss konstant in einem Temperaturbereich von etwa 10 bis 40 °C gehalten werden, wobei dafür in der Regel eine Flüssigkeitskühlung verwendet wird.
Kein Kühlergrill, besserer Luftfluss
Der Elektromotor ist so effizient, dass auf die klassischen grossen Kühleröffnungen verzichtet werden kann – ideal für die Aerodynamik.